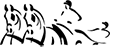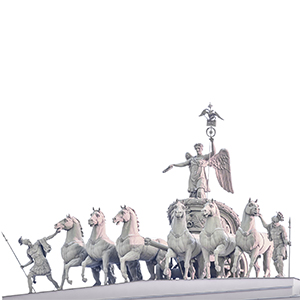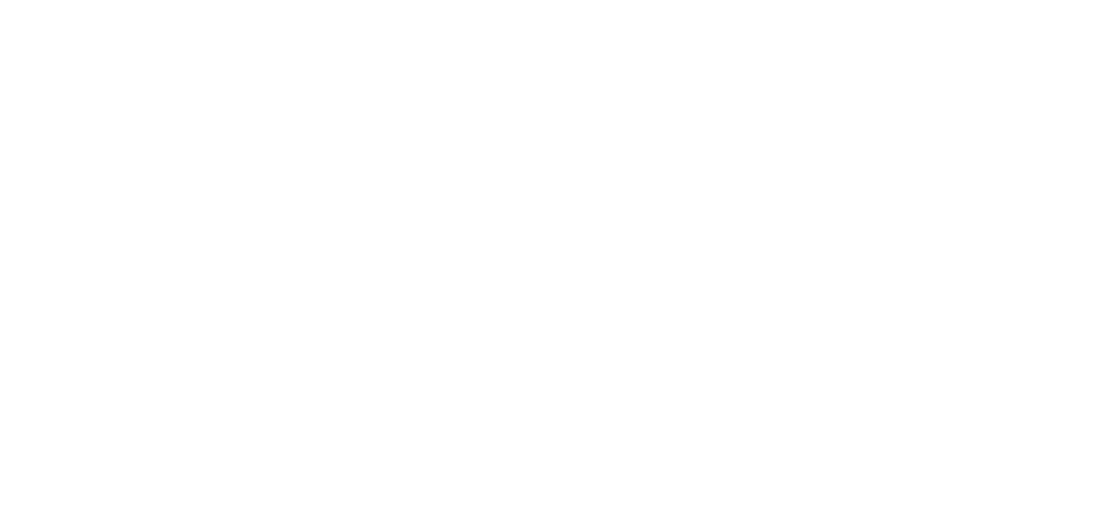- Read Time: 1 min
Ein Blick zurück:
Gefahren wurde bereits zu einem Zeitpunkt als noch niemand
an das Reiten dachte. Man schrieb etwa das Jahr
4000 v. Chr. als zum ersten Mal Rösser im Zweistromland
des Euphrat und Tigris, dem heutigen Irak, angespannt
wurden. Das Rad war erfunden und Pferde, bzw. zunächst
sogenannte Onager (Halbesel), vor den Wagen gespannt.
Lasten und Personen konnten von nun an über grössere
Strecken transportiert werden. Danach kam die Zeit des
Streitwagens. Bei der Schlacht von Kades (1296 v. Chr.)
standen 3500 hethitische Streitwagen bereit und weitere
1000 in Reserve. Später kamen die Zeiten, nach der
sich der Fahrsport noch heute sehnt: Fahren war bei den
Griechen und Römern eine Olympische Disziplin. Von
allen Teilnehmern der Olympischen Spielen, genossen
die Fahrer das höchste Ansehen. Olympiasieger im Fahren
wurden Ehrenbürger ihrer Stadt und hatten materiell
ausgesorgt. Für die Champions von heute ist dies alles undenkbar.
Bedeutung erlangte das Fahren zunächst alleine
in den Bereichen Transport oder Reisen. Wichtig waren sie
auch für das Militär.